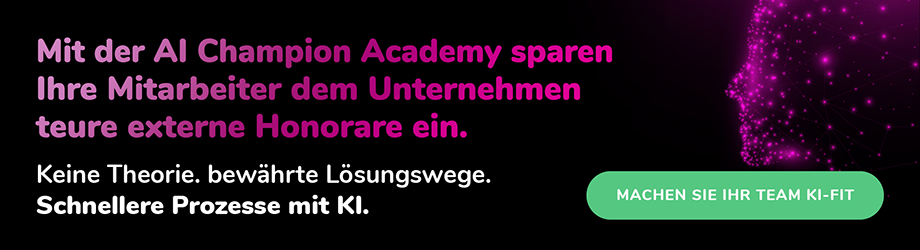Unterhalb der Kraaker Tannen im Landkreis Ludwigslust-Parchim verbirgt sich seit 25 Jahren der HanseWerk-Kavernenspeicher Kraak. In mehreren Hohlräumen auf rund 1.000 Meter Tiefe lagert er bis zu 202 Millionen Kubikmeter Erdgas und deckt damit den Jahresbedarf von zirka 120.000 Haushalten. Die Anlage wurde seit der Inbetriebnahme 2000 kontinuierlich ausgebaut. Politiker und Aufsichtsbehörden würdigen am 30. September das anhaltende Sicherheits- und Effizienzniveau des Speichers. Digitale Überwachung und Prozessoptimierung stärken zusätzlich Betriebssicherheit.
Inhaltsverzeichnis: Das erwartet Sie in diesem Artikel
Kavernenbildung durch Solung schuf 66 Fußballfelder großen Lagerraum unterirdisch
Bereits 1998 begann HanseWerk in Mecklenburg-Vorpommern mit der systematischen Erschließung eines Salzstocks unterhalb der Kraaker Tannen. Durch das Auslösen von Salz mittels Solung entstanden Kavernen, die heute ein Speichervolumen von 202 Millionen Kubikmetern Erdgas ermöglichen. Diese Anlage gewährleistet das Jahresvolumen von etwa 120.000 Haushalten. Die erste Kaverne wurde im Jahr 2000 in Betrieb genommen. Seither erfolgten zahlreiche Erweiterungsmaßnahmen und technische Modernisierungen. Mit kontinuierlicher Optimierung, betrieblicher stetiger Weiterentwicklung und umfassender Qualitätssicherung.
Merkt fordert Wertschätzung des digitalen Speichers in stabilen Zeiten
Der technische Vorstand der HanseWerk-Gruppe, Dr. Benjamin Merkt, lobt die Leistungsfähigkeit des Kavernenspeichers Kraak, der seit 25 Jahren durch kontinuierliche Betriebsoptimierung und fortschrittliche digitale Steuerung ein hohes Maß an Betriebssicherheit gewährleistet. Er unterstreicht, dass der Speicher nicht nur in Krisensituationen unverzichtbar fungiert, sondern selbst in Phasen stabiler Nachfragesituationen Anerkennung findet, da seine effiziente Prozesssteuerung, Automatisierung und Transparenz eine flexible sowie nachhaltige Energieversorgung ermöglichen. Merkt sieht Kraak als zentralen Versorgungsanker, unverrückbar.
Zentraler Versorgungsanker Kraak deklariert mit digitaler Steuerung und Wasserstoffpotenzial
Im Gespräch betont Dr. Wolfgang Blank, Wirtschaftsminister Mecklenburg-Vorpommern, dass der Kraak-Speicher im Zuge der Dekarbonisierung Potenzial für Wasserstoffanwendungen erschließt. Sebastian Heinermann von INES hebt die digitale Automatisierung hervor, die effiziente Betriebsabläufe und flexible Reaktionsfähigkeit ermöglicht und den Speicher zu einem Stabilitätsanker macht. Dazu bestätigen Alexander Kattner vom Bergamt Stralsund sowie Amer Abdel Haq von UGS die robusten geologischen Eigenschaften des Salzstocks, die ideale Voraussetzungen für die Speicherung neuer Gasmoleküle schaffen.
Unter hohem Druck erfolgten Solungen 1992, Betrieb ab 2000
Im Jahr 1992 begann die gezielte Lösung des Salzkörpers mit Hochdruckwasserinjektionen, um untertage Hohlräume zu schaffen, die als Speicherkavernen dienen. Nach umfangreichen Präparations- und Sicherheitsprüfungen nahm man am 27. September 2000 die erste fertiggestellte Kaverne in den regulären Betrieb. In den folgenden Jahren wurden weitere Solungen durchgeführt und gastechnische Einrichtungen kontinuierlich ausgebaut, bis die Gesamtvolumenkapazität des Untertagelagernetzes etwa 202 Millionen Kubikmeter erreichte und seitdem effizient und nachhaltig in Betrieb.
Geometrie und Dichte des Salzstocks schaffen dauerhafte, optimale Untertagesspeicherung
Unter der Erdkruste befindet sich ein mächtiger Salzstock mit Abmessungen von etwa sieben Kilometern mal viereinhalb Kilometern. Zwischen 400 und 4.700 Metern Tiefe sind Salzkörnungen konzentriert, in die auf rund 1.000 Metern künstliche Kavernen platziert wurden. Diese Hohlräume erstrecken sich senkrecht über bis zu 177 Meter und überragen damit die Höhe des Schweriner Doms um rund 60 Meter. Die Kombination aus Geländebilanz, Geometrie und Salzkompaktheit garantiert dichte, beständige, dauerhafte Energiespeicherung.
Kombinierte Gas und Wasserstoffnutzung im Kavernenspeicher Kraak bleibt realistisch
Im Zuge von Prüfungen zur Transformation des Kavernenspeichers hin zur Wasserstoffnutzung hat HanseWerk durch Studien bewiesen, dass die Salzstruktur eine hohe Integrität und Abdichtungsfähigkeit aufweist. Bislang werden Ergebnisse gesammelt, ohne dass konkrete Maßnahmen beschlossen wurden. Dabei fließen fundierte Erkenntnisse aus 25 Jahren Gaslagerung ein, um technische Herausforderungen zu adressieren. Dank dieser praxisnahen Expertise bleibt die Vision einer dualen Speicherung von Erdgas und grünem Wasserstoff langfristig realisierbar und stärkt die Versorgungssicherheit.
HanseWerk Kraak: entscheidender Beitrag zur deutschen Energiewende und Versorgungssicherheit
Mit einer seit 25 Jahren verlässlichen Betriebsführung demonstriert der Kavernenspeicher Kraak hohe technologische Qualität und systemische Bedeutung. Durch adaptive Druckregelung und digitalisierte Prozesssteuerung ermöglicht er die flexible Speicherung und Bereitstellung großer Gasvolumina, die den Bedarf von rund 120.000 Haushalten absichern. Die robuste Salzstruktur bietet nicht nur exzellente Dichtigkeit, sondern ebnet auch den Weg für zukünftige Wasserstoffeinlagerung. Damit trägt Kraak entscheidend zur Stabilität und Transformation des Energiesystems bei. Gewährleistet regional Resilienz.